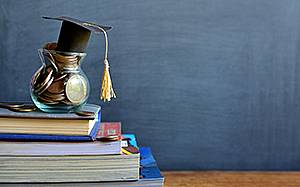Wir bieten Ihnen ein interdisziplinäres Studium, das die beiden Wachstumsbereiche Technik und Gesundheit miteinander verschränkt und Sie perfekt auf die Praxis vorbereitet. Bei Laborarbeiten bieten sich Ihnen viele Gelegenheiten, die Anforderungen des Berufsfeldes kennenzulernen und konkrete Aufgabenstellungen durchzuspielen. Interdisziplinäre Projekte sind Teil der Forschungsstrategie unserer Hochschule. Als Studierende*r sind Sie dabei, die Forschung in fachübergreifenden Projekten an der Schnittstelle von Technik und Gesundheit voranzutreiben. Das hilft Ihnen wiederum in der Praxis, wenn Sie auf Ihre daraus gewonnenen und wissenschaftlich abgesicherten Kenntnisse aufbauen können.
Das Masterstudium Health Tech and Clinical Engineering ist der österreichweit erste Masterstudiengang für die Koordination von technischen Systemen im Gesundheitswesen. Der Themenmix aus Kenntnissen der Medizintechnik, Informationstechnologie, Gebäudeautomatisierung, ergänzt um Führungs- und Managementkenntnisse, ist ideal für Ihre vielseitige Karriere im Gesundheitswesen. In zahlreichen Laborübungen während Ihres Studiums arbeiten Sie an konkreten Fallbeispielen, mit denen Sie in Ihrer Berufsausübung konfrontiert werden.
Jedes Semester setzen Sie sich als Teil eines Projektteams mit verschiedenen Aufgabenstellungen auseinander.